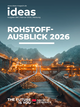Interview
Veränderte Globalisierung eröffnet neue Möglichkeiten – Interview mit Jürgen Matthes, Institut der deutschen Wirtschaft
ideas: Herr Matthes, Sie sind Leiter des Themenclusters Internationale Wirtschaftspolitik, Finanz- und Immobilienmärkte am Institut der deutschen Wirtschaft. Deutschland wird oft als der »kranke Mann Europas« bezeichnet. Halten Sie diese Einschätzung für gerechtfertigt?
Jürgen Matthes: Teilweise schon. Unser Problem sind lange verschleppte Reformen der Investitions- und Produktionsbedingungen hierzulande. Dazu kam schon vor 2020 eine immer stärker überbordende Bürokratie, die gerade kleinere und mittlere Unternehmen stark belastet – und auch die Herausforderungen der Dekarbonisierung sind zu nennen. Dann kamen die Coronakrise und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Lieferketten funktionierten nicht mehr, viele industrielle Produkte wurden deutlich teurer und auch die Energiekosten stiegen stark. Und jetzt müssen wir noch mit der erratischen Zollpolitik des US-Präsidenten klarkommen und zusehen, wie China als Exportmarkt für die deutsche Wirtschaft implodiert. Es kommt nun darauf an, dass wir diesem Gegenwind starke konsequente Reformen für mehr Wettbewerbsfähigkeit entgegenstellen, um wieder Fahrt aufzunehmen.
Sehen Sie, dass das in diesem Jahr beschlossene Konjunkturpaket die Stellung Deutschlands im internationalen Wettbewerb signifikant verbessern kann?
Das ist zu hoffen, aber es ist nicht garantiert. Es kommt darauf an, ob der Staat die durch zusätzliche Schulden aufgenommenen Gelder gut investiert und das Investitionspaket zügig umsetzt. Die Verschiebebahnhöfe der Regierung, also die Kürzung von Investitionsausgaben im normalen Haushalt, sind hier schlechte Zeichen. Die Zusätzlichkeit der Investitionen ist vor allem bei den 100 Milliarden für die Bundesländer nicht gewährleistet. Die Regierung sieht, dass sie Genehmigungsverfahren stark beschleunigen und am Fachkräftemangel etwas tun muss, damit die Gelder schnell eingesetzt werden und nicht in höheren Preisen verpuffen. Wir empfangen derzeit also gemischte Signale.
Ein weiteres Thema, das die deutsche Wirtschaft beschäftigt, ist die Zollpolitik der USA unter Präsident Trump. Wie bewerten Sie den Deal, den die EU mit den USA ausgehandelt hat, und welche Auswirkungen hat er auf den »Exportweltmeister Deutschland«?
Der Deal ist so mau ausgefallen, weil Donald Trump die Sicherheitspolitik und die Ukraine-Hilfe auf den Verhandlungstisch gelegt hat. Weil wir hier eine offene Flanke haben, ist die Europäische Kommission eingeknickt. Unser langjähriges Trittbrettfahrertum bei der Landesverteidigung bezahlen wir teuer.
Die Zölle sind zweifellos schädlich für die deutsche Exportwirtschaft. Doch wenn es bei 15 Prozent als Obergrenze bleiben würde, kommen viele Firmen damit wohl noch einigermaßen zurecht. Ein großes Problem sind die zusätzlichen 50-prozentigen Stahlzölle der USA, die auch für weiterverarbeitete Produkte mit Stahl- und Aluminiumgehalt gelten. Sie treffen vor allem den deutschen Maschinenbau hart, der oft noch hier produziert und auf offene Exportmärkte angewiesen ist.
Aber: Die USA sind zwar mit gut 10 Prozent der größte deutsche Exportmarkt, aber damit gibt es fast 90 Prozent der Ausfuhren, die nicht dorthin gehen. Europa steht für gut zwei Drittel und hier ist noch viel zu holen, wenn wir in der EU konsequent die Wettbewerbsfähigkeit verbessern und die Hürden im Binnenmarkt weiter abbauen.
Nicht nur die USA, sondern auch China stellt Deutschland vor große Herausforderungen. Wie bewerten Sie die Rolle von Innovationskraft und staatlicher Förderung in China im Kontext der globalen Wettbewerbsdynamik?
Chinesische Unternehmen bieten ihre Produkte oft 30 bis 50 Prozent billiger an als deutsche Firmen, hören wir aus der Wirtschaft. Das kann schlichtweg nicht mit rechten Dingen zugehen. Zahlreiche chinesische Firmen haben zwar in Sachen Effizienz und Innovationskraft ihre Hausaufgaben gemacht. Aber ein so großer Preisvorteil beruht mit großer Sicherheit auch auf erheblichen Wettbewerbsverzerrungen durch staatliche Subventionen und auch durch einen deutlich unterbewerteten Yuan gegenüber dem Euro.
Welche politischen Strategien könnten Deutschland und die EU verfolgen, um fairen Wettbewerb mit China sicherzustellen und gleichzeitig gezielte Kooperationen zu fördern?
Die Kooperationsfelder mit China sind – mit der wichtigen Ausnahme vor allem des Klimaschutzes – immer weniger geworden. Zudem ist es zu einem veritablen Systemwettbewerb gekommen, bei dem China sich mit seinem Staatskapitalismus den liberalen europäischen Demokratien überlegen sieht. Wie Russland arbeitet es kräftig daran mit, über Desinformationen die demokratischen Fundamente hier erodieren zu lassen und rechte Parteien zu unterstützen. Auch der Handel ist immer weniger von Win-win-Konstellationen geprägt. Stattdessen sind Chinas Exportbeschränkungen von Seltenen Erden eine klare Erpressungsstrategie. Auch hier haben wir übrigens jahrelang zugesehen, wie die Abhängigkeit von China immer größer wurde, weil es dort so schön billig war – und bezahlen jetzt dafür umso teurer.
Gibt es zurzeit kritische Abhängigkeiten in deutschen Lieferketten, die dadurch besonders betroffen sind?
Wir wissen über die hohen Abhängigkeiten bei Seltenen Erden. Doch es gibt noch deutlich mehr Produkte, bei denen wir über Jahre mehr als 50 Prozent aus China importieren, wie ich hier gezeigt habe. Das Problem dabei: Wir wissen oft nicht, ob diese Importabhängigkeiten wirklich kritisch sind, weil die Produkte unverzichtbar und kurzfristig schwer ersetzbar sind.
Der Trend geht derzeit von Globalisierung hin zu Deglobalisierung. Oder wie sehen Sie das?
Ich denke, dass wir weniger eine Deglobalisierung sehen, sondern eine veränderte Globalisierung. Es dürfte längerfristig weitergehen mit einer gewissen Entkopplung zwischen dem Westen und dem Block der Autokratien um Russland und China. Doch dafür eröffnen sich neue Handelsmöglichkeiten mit den anderen Schwellenländern.
Welche Rolle sollte die Bundesregierung dabei spielen, um Wirtschaftspolitik, Außenpolitik und Sicherheitsinteressen besser miteinander zu verzahnen?
Wir müssen beides stärker miteinander verknüpfen. Das Stichwort ist hier Wirtschaftssicherheit. Wir brauchen beispielsweise eine Regierungs-Taskforce zur Durchleuchtung unserer kritischen Abhängigkeiten, einen konsequenten Schutz unserer kritischen Infrastruktur vor Russland und China sowie eine konsequente Bekämpfung von Wettbewerbsverzerrungen im Handel.
Vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte Anja Schneider.